Geschichte der Wirgeser Glasfabrik Teil 2 von 1902-195
1902 erwirbt die
Aktiengesellschaft für Glasindustrie, vormals Friedrich Siemens Dresden
die Fabrikanlagen mit der Flaschenfabrik, Chamottefabrik und
Verschlussfabrik in Wirges.
Friedrich Siemens, Konstrukteur des ersten
Gas-Regenerativofens im Jahre 1859. Dieses Feuerungssystem und seine
Erfindung der Wannenschmelzöfen brachten eine vollständige Umwälzung in
der Glasindustrie hervor. Damit legte er den Grundstein für die deutsche
Flaschenindustrie und baute im In- wie im Ausland seine Wannenöfen.
Aus den Siemens’schen Unternehmen entstand im
Jahre 1888 die Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie mit Sitz in
Dresden.
Die Gebrüder Siemens waren auf vielen Gebieten
vertreten. Friedrich war als Assistent bei seinem Bruder Werner Siemens
auf dem Gebiet der Telegrafie tätig, bevor er nach England reiste, um
mit Wilhelm Siemens seine Erfindungen im Motoren- und Maschinenbau
einzuführen. 1867 übernahm Friedrich die von Hans Siemens gegründete
Glasfabrik für Tafelglas und wandelte diese in eine Flaschenfabrik um.
Friedrich Siemens der Erfinder der kontinuierlich arbeitenden Wannenöfen mit Regenerativfeuerung für die Massenerzeugung von Glas (seit 1868) stellt die Glasproduktion auf sein System um und modernisiert den Betrieb in den Folgejahren. Die Erfindung von Werner von Siemens, kam in der elektrischen Werkbahn zur Anwendung. Im Gegensatz zu seinem Bruder, Werner wurde er nicht geadelt und trägt damit auch nicht das Adelsprädikat „von“ im Namen.
Die Aktiengesellschaft für Glasindustrie, vormals
Friedrich Siemens Dresden, hatte mit den staatlichen Mineralbrunnen in
Selters, Löhnberg und Fachingen im Jahre 1894
einen Vertrag zur Lieferung von Glasflaschen abgeschlossen, womit das
Schicksal der Krugbäckereien, als ehemalige Zulieferer, besiegelt war.
Vertraglich waren noch Lieferungen von 2 Mio Tonkrügen festgelegt.
Die Glasflasche trat ihren Siegeszug an.
1911 wurde die
erste Owens-Flaschenmaschine an der Schmelzwanne III aufgestellt,
Tagesproduktion 20.000-25.000 Flaschen (in späteren Jahren 30.000
Flaschen).
1912 folgte eine
weitere Owens-Maschine. Die maschinell hergestellten Flaschen zeichneten
sich durch größere Bruchfestigkeit sowie Gleichmäßigkeit des Gewichtes
und Inhaltes aus. Nach und nach verdrängten diese Maschinen die
mundgeblasenen Flaschen. Für Spezial-Produkte wurde immer noch die
Fertigkeit der Glasbläser benötigt.
Owens-Flaschenmaschine
war ein amerikanisches Patent, das die europäische Flaschenindustrie für
12 Mio Mark erwarb
Die Feldbahngleise in 600 mm Spurweite verbanden
die einzelnen Sparten des Werkes und bewältigen den Transport von
Rohstoffen für die Glasherstellung, Kohlen und Brikett für die
Gaserzeuger denn die Schmelzwannen werden mit Gas gefeuert. Die
Brennstoffe wurden in sogenannten Drehrosten verschwehlt, das daraus
gewonnene Gas zur Befeuerung der Wannenöfen benutzt. Feuer- und
Säurefeste Produkte der Chamotte werden zur Verladerampe transportiert
um in Staatsbahnwagen verladen zu werden. Das Werk verfügt aber auch von
Anfang an über etwa 2,5 km Normalspurgleise im Fabrikgelände zur
Anlieferung von Baumaterialien, Maschinen, Ersatzteilen, Rohstoffen,
Brennmaterial und zum Versand der Glasprodukte.
1917 erwarb die
Aktiengesellschaft für Glasindustrie in Wirges die an das Werksgelände
anschließenden Tonfelder und Belehnungen und sicherte sich damit der
Schamottefabrik auf lange Sicht eine gesunde Rohstoffgrundlage.
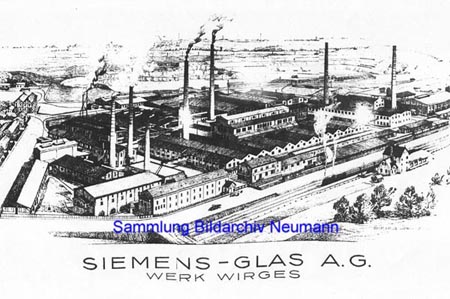

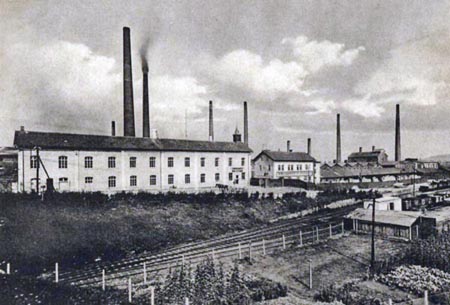

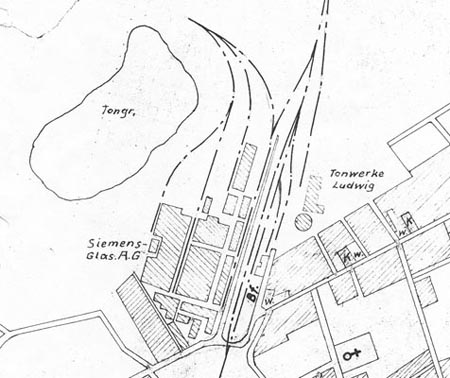



Werksstilllegungen infolge der Ruhrbesetzung
1923-24 und der Weltwirtschaftskrise
1930-1933.
Ende 1933 kam
die Schamottefabrik sowie die Glashütte mit 2 Schmelzwannen und 2
Owensmaschinen mit etwa 550 Beschäftigten wieder in Betrieb.
1934 wurde an der Wanne III eine Anlage
zur Herstellung vonRohglas und Drahtglas im Handgießverfahren errichtet,
die schon 1939 wieder stillgelegt
wurde, weil dieses Verfahren inzwischen unrentabel war.
(Quelle
Heimatjahrbuch Alois Baltes 1994)
Im
Jahre 1943 erfolgte die Umbenennung in
Siemens Glas AG.
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges verblieb nur das
Werk Wirges im Bundesgebiet alle übrigen Werke von Siemens-Glas lagen in
den verlorenen Ostgebieten oder in der sowjetischen Besatzungszone.
Es handelte sich um die Werke Usch, Gertraudenhütte, Neusattl, Kosten,
Mediasch und Graz in der Tschechoslowakei, Polen, Rumänien und
Österreich. In der sowjetischen Besatzungszone Dresden, Berlin-Stralau,
Freital-Döhlen und Pirna.
Carl Friedrich Siemens, der Sohn von Friedrich Siemens war seit
den zwanziger Jahren stellvertreter und später Vorsitzender des
Aufsichtrates. Er verstarb am 25. Juni1952
Das bebaute
Werksgelände in Wirges umfaßte 37.175 qm, unbebautes Werksgelände
110.658 qm, Wohnhausgrundstücken von 65.545 qm, landwirtschaftliche
Grundstücke von 60 883 qm und über 10 ha Tongruben.
Quelle: Glück und Glas, Denkschrift der
Westerwald AG (Original im Archiv)
Zunächst widmete man sich dem Wiederaufbau der seit Ende März 1945
stilliegenden Werksanlagen. Diese waren nicht durch Kriegseinwirkungen
zerstört aber
durch die Siegermächte, vor allem französische Besatzung, nicht mehr im
produktionsfähigen Zustand.
Neu aufgenommen wurde
die Fabrikation von technischen Gläsern, gepreßtem Bauglas und von
Glasdachziegeln, sowie von technischem Porzellan.
(Dr. Warnecke stammte aus Hannover und besaß ein Wohnhaus gegenüber der
heutigen Werkseinfahrt.)
Während viele Firmen in der Nachkriegszeit einen
erfolgreichen Neubeginn erreichen konnten, blieb in Wirges der Erfolg
aus.
Mangelnde Sparsamkeit, unglückliche
Personalpolitik und unüberlegte Investitionen lassen die
Leistungsfähigkeit des Unternehmens sinken. Die Fusion im Jahre 1955 mit
der Oldenburgischen Glashütten AG erweist sich als Fehlschlag.
Auszug aus den Hauptversammlung 1955 (veröffentlicht in der FAZ im Mai
1956)
Der Vorstand besteht zur Zeit aus den Herren:
Bernd Neesen, Wirges, stellv.
Dem Aufsichtsrat, der satzungsgemäß aus sechs Mitgliedern besteht,
gehören zur Zeit folgende Herren an:
Dr. jur. Eduard von Schwartzkoppen, Frankfurt/Main, Geschäftsinhaber der
Berliner Handels-Gesellschaft, Vorsitzer,
Walter Nadolny, BerlinCharlottenburg, stellv. Vorsitzer,
Dr.-Ing., Dr-Ing. E.H. Otto Reuleaux, Hannover-Kirchrode, Vorsitzer des
Vorstandes der Kali-Chemie AG in Hannover
Arbeitnehmervertreter:
In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Koblenz ist wiederholt von Bilanzfälschung und Bereicherung der Angeklagten die Rede. Alle Bilanzen wurden im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Aufwendungen im Geschäftsjahr 1954: 5 144 546,27 DM davon 4 053 502,48 DM an Löhnen und Gehältern.
|
Wirges |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
|
Arbeiter |
626 |
711 |
785 |
716 |
791 |
|
Angestellte |
90 |
94 |
105 |
108 |
119 |
Arbeitsgebiete Werk Wirges aus dem
Geschäftsbericht von 1955
Glasfabrik
Getränkeflaschen aller Art, farbig und weiß, eingebrannte Farbetiketten für Flaschen, gepreßtes Bauglas, vorzugsweise Glasdachziegel, hohle und massive Glasbausteine sowie technische Gläser, wie Wasserstandsschutzgläser, Backofenscheiben, Schutzglocken für elektrischeb Lampen, Hüttenrohglas für Beleuchtungsglas-Raffinerien usw.
Schamottefabrik
Die Schamottefabrik umfaßt drei Arbeitsgebiete,
und zwar:
1. für den industriellen Bedarf an feuerfesten
Materialien, wie Hochöfen, Röstöfen, Schmelz- und Vergütungsöfen u. dgl.
Mit den unter den eingetragenen Schutzmarken eingeführten
Sonderqualitäten „ALUSIEM“, „VITROSIEM“, „DUROSIEM“ und POROSIEM“.
2. für den Bedarf der Chemischen Industrie an
säurebeständigen Materialien, wie Normal- und Formsteine, Stampfmassen,
Mörtel und Kitte mit ihren geschützten Sonderqualitäten „SIEMACID“ und
„SIEMENSIT“.
3. Projektierung und Ausführung von
Korrosionsschutz an Anlagen und Gebäuden, wie Beiz- und
Neutralisationsanlagen, Glovertürme und alle sonstigen vorkommenden
Reaktionstürme, Kanäle u. dgl.
Tongruben
Gewinnung von Ton als Rohstoffbasis für die
Schamottefabrik und für den Weiterverkauf.
Wandler- und Transformatoren-Werk
Herstellung von Niederspanngs- und
Hochspannungs-Strom- und Spannungswandlern in Giesharz-, Oel- und
Porzellanausführung. Regeltransformatoren, Regelaggregate, Bau von
Hochspannungs-Prüf-Transformatoren und Hochstrom-Transformatoren.
Porzellanfabrik
Für den Anlagenbau stellt die Gesellschaft
armiertes Porzellan in Form von Durchführungen und Stützern her.
Fertigung von Hochspannungs-Geräte-Isolatoren für das eigene Werk und
für den Verkauf, Fertigung von Leitungsisolatoren für Hoch- und
Niederspannung
Betriebsanlagen
Das Wirgeser Werk war
zum Neubeginn Schuldenfrei, verfügte über Lager und größere von Dresden
übernommene Effektenbestände und doch geriet die Firma nach wenigen
Jahren in Schwierigkeiten
In den Jahren 1956/57 wurden die Werkswohnhäuser
der Dornberg- und Asbach Siedlung sowie die Häuser an der neuen Straße
an zumeist Werksangehörige verkauft.
Die Berliner Handelsbank gewährte nochmals
einen Kredit von 10 Millionen Mark, das Land Rheinland-Pfalz eine
Bürgschaft von 1,6 Mio DM aber der Konkurs war nicht mehr abzuwenden.
Mitte August
1957
stellte die Firma Siemens-Glas AG ihre Zahlungen ein und es kam zur
Einleitung des Konkurses.
Mehr dazu am Ende dieser Seite
Das Schicksal von Siemens-Glas ist besiegelt
Pressemeldung vom 26. September 1957
Es ist sicherlich ein schwerer Gang
für einen angesehenen Bankier, wenn er in seiner Eigenschaft als
Vorsitzender des Aufsichtsrats einer mit seinem Hause über Generationen
hinweg befreundeten Gesellschaft deren Hauptversammlung mitteilen muß,
daß das Gericht ein Konkursverfahren eingeleitet hat. In einem solchen
Augenblick vermag, er nichts zu bieten als Verluste und Enttäuschungen;
er kann keine Hoffnungen mehr erwecken, denn das Schicksal des
Unternehmens ist entschieden, und dennoch muß er um Vertrauen werben,
denn darauf beruht seine Existenz als Bankier. Vor diese sicherlich sehr
schwierige Lage sah sich der Geschäftsinhaber der Berliner
Handels-Gesellschaft, Dr. von Schwartzkoppen, in der HV der Siemens-Glas
AG, Wirges, gestellt.
Das Bankhaus Lenz & Co (74%), deren Inhaber
August Lenz und Dr. Otto Schmitz, und die Glas- und Spiegelmanufaktur AG
in Gelsenkirchen (26%) erwerben aus der Konkursmasse die Glashütte,
Schamottefabrik, WTW und Tongruben und führen das Werk unter dem alten
Namen Siemens-Glas AG fort.
Dr. Werner Wodrich, langjähriger Direktor der
Siemens Glas AG in Dresden, war seit 1949 Vorstand der Glas- und
Spiegelmanufaktur AG in Gelsenkirchen, wird von den neuen Aktionären für
die neue Siemens-Glas AG zum allein Vertretungsberechtigten Vorstand
ernannt. Dr. Ing. Heinrich Warnecke wird stellvertretendes
Vorstandsmitglied. Prokura erhalten Dr. Günther König, Werner Bettermann
und Alfons Plewnia.
Schon im Januar 1958
nahm die Glashütte wieder den Betrieb auf, wenige Monate später auch die
übrigen Betriebsteile Schamotte, Tonguben und die WTW ihre Arbeit wieder
auf. Überlegte Investionen und eine verantwortungsvolle Geschäftspolitik
des neuen Vorstandes führten innerhalb kurzer Zeit zur Verdoppelung der
Umsätze.
Um sich vom großen Elektro Konzern Siemens zu
Unterscheiden wurde die Firma am 30. Juni 1959
in Westerwald AG geändert und firmierte nun unter WESTERWALD AG vormals
Siemens Glas.
Lieber Besucher und Leser bei Interesse für die Verwendung dieser Texte geben sie auf jeden Fall die Quelle an oder verlinken diese Seite.
Die Zeit Nr. 38/1957
Auf der HV der
Siemens-Glas AG, Wirges/Westerwald, die am 20. September stattfindet,
wird es voraussichtlich sehr lebhaft zugehen. Das Unternehmen hat
Konkurs anmelden müssen und kein Aktionär weiß zur Zeit, wieviel seine
Aktien noch wert sind. Das ist umso peinlicher, als die Verwaltung auf
der HV im vergangenen Jahr noch einen betonten Optimismus zur Schau
getragen hat. Schuld an dem Zusammenbruch ist einmal der harte
Wettbewerb in der Glasindustrie, aber auch ein gewisses Versagen des
inzwischen abgelösten Alleinvorstandes. Nunmehr wurde festgestellt, daß
die Vermögenswerte zu hoch in der Bilanz eingesetzt waren – und das,
obwohl der Wirtschaftsprüfer der Bilanz per 31. 12. 55 seinen
Bestätigungsvermerk erteilt hat. Die Schutzvereinigung hat zu
verschiedenen Tagesordnungspunkten Opposition angemeldet. Ihr geht es
offensichtlich darum, die für die Verluste Verantwortlichen
festzustellen.
Die Zeit Nr. 39/1957 Auszugsweise
Die Hauptaktionäre waren nicht bereit, dem
Unternehmen neue Mittel zuzuführen. Es war unmöglich, am offenen Markt
eine Kapitalerhöhung durchzuführen (die Gesellschaft arbeitete ja mit
Verlusten), auch sonst fand sich niemand, der sich an dem Unternehmen
beteiligen wollte. Mühe hat sich der AR nach dieser Richtung hin zur
Genüge gegeben.
Warum aber, und dies ist die zweite
wesentliche Frage, wurde die Unmöglichkeit, das Unternehmen zur
Wirtschaftlichkeit zu bringen, nicht zu einem Zeitpunkt erkannt, wo
vielleicht noch etwas zu retten war? Dazu ist vieles zu sagen. Weil
Siemens-Glas kein kaufmännisches Vorstandsmitglied fand, ließ sich das
Unternehmen von
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beraten. Sie richteten
die Buchhaltung ein und überprüften die Kalkulationen.
Noch im Herbst vergangenen
Jahres erstattete eine renogutachten. Es ließ die
Hoffnung für berechtigt erscheinen, daß Siemens-Glas
vor der Schwelle der Rentabilität stünde. Im
Frühjahr aber geriet die Gesellschaft in eine häßliche
Liquiditätsklemme. Die Hausbank, die Berliner Handels-Gesellschaft,
sprang nochmals ein. Sie veranlaßte daraufhin erneut eine
Wirtschaftlichkeitsüberprüfung. Diesmal aber zeigte sich, daß die
Abschreibungssätze, die bisher angewandt wurden, nicht ausreichten. Sie
berücksichtigten lediglich den technischen, aber keineswegs den
wirtschaftlichen Verschleiß veralterter Maschinen. Weiterhin zeigte
sich, daß auf die Vorräte größere Sonderabschreibungen notwendig wurden.
Eine auf Grund dieser Feststellung aufgestellte Zwischenbilanz ergab,
daß das halbe
Aktienkapital verloren war. Damit aber war die
Verwaltung gehalten, Anzeige gemäß § 33 des Aktiengesetzes zu erstatten.
Mit drei Freisprüchen endete am Dienstag der Siemens-Glas-Prozeß der am 8. April vor der fünften großen Strafkammer des Landgerichts Koblenz begonnen hatte. Die Kosten des Verfahrens fallen der Staatskasse zur Last.
Schon 1955 war eine deutliche
Liquiditätsklemme zu erkennen.
Erhebliche Investitionen
hatten die Aufnahme
von 10. Mio Mark erfordert, die durch kurzfristige Gelder beschafft
wurden.
1956 habe sich dann der Abbau dieser Kredite
als zwingend erwiesen. Das Land Rheinland-Pfalz hatte eine
Ausfallbürgschaft von 1,6 Mio Mark gestellt.
In der Aufsichtsratsitzung vom 10. August
1957 sei dann Dr. Niclassen und dem Geschäftsführer Bernd Neesen
nahegelegt worden , auszuscheiden.
Der wenig später angemeldete Konkurs – 20
Millionen Mark – fand mit einem Zwangsvergleich seinen Abschluß